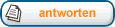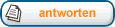|
Bemerkungen zur
SKALA DER AUSBILDUNG
Auf der Grundlage der Vorträge von Dr. Carsten M., Richter und Reiter bis Klasse S.
Ergänzt durch Beiträge und Zitate aus der Reitliteratur. Verfasser: HDV12
Dezember 2004
Vortrag Dr. M., Teil I vom 06.11.2004
Grundsätzlich geht es um die Skala der Ausbildung (SdA), die unter den Aspekten der angewandten Reitlehre und der funktionellen Anatomie des Pferdes dargestellt wird. Dabei steht ihre praktische Umsetzung in der Ausbildung d. P. und im Dressurreiten i. e. S. im Vordergrund. Hauptaugenmerk des Trainings mit fortgeschrittenen Reitern ist d. P., dessen Bewegungskorrektheit und –qualität, soweit Letzteres nicht naturfixiert ist. Sind R. u .P. auf dem richtigen Weg, wird die Abfolge der Übungen und werden die damit verbundenen Anforderungen folgerichtig entwickelt? Dabei sind kleine Fehler verzeihlich, solange die Grundlage stimmt, d. h. der richtige Weg eingehalten wird. Ausbilder und Richter müssen einen „selektiven Blick“ vermeiden. Sie dürfen nicht nur die ausgeführte oder fertige Lektion sehen, sondern auch deren Einleitung (HP, evtl. zwingende Vorübungen, z.B. versammelten Schritt vor der Schrittpirouette) und den Übergang zur folgenden Aufgabe oder auch nur das Verlassen der Übung.
DRESSUR IST BEWEGUNG UND HALTUNG!
Dabei folgt die Form, besser die Haltung, der Bewegung. Sie ist also Funktion der Aktivität der Hinterbeine (HB) und deren zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Möglichkeiten an Beweglichkeit, Geschmeidigkeit und Kraft. Zwischen Form und Bewegung besteht ein dynamischer Zusammenhang, im besten Falle ein sich gegenseitig bedingendes dynamisches Gleichgewicht. Ziel der gesamten Ausbildung, aber auch jeder Klasse, ist die Durchlässigkeit.
VORHAND STÜTZT – HINTERHAND BEWEGT
Wichtig ist es, Schulterfreiheit mithilfe der Seitengänge zu erzielen. Um ein schädigendes und verschleißendes Laufen auf der Vorhand, was die Vorhand zusätzlich binden würde, zu vermeiden, muss echte Versammlungsfähigkeit bereits gegeben sein.
16. BWK: Sein Dornfortsatz steht senkrecht. Hier sitzt der Reiter in der tiefsten Stelle des Sattels. Er teilt d. P. in vorne und hinten. Alles, was davor ist, muss bergauf gehen, alles dahinter muss tief werden und in der Folge immer mehr hin zum Schwerpunkt treten. Lastaufnahme ist Langzeitziel.
Angemessenes Tempo und Gleichgewicht fördern den Takt. Ruhe! Takt ist das räumliche und zeitliche Gleichmaß in den drei Grundgangarten, also in Schritten, Tritten und Sprüngen. Er muss nicht nur auf geraden Linien, sondern auch in allen Übergängen und Wendungen erhalten bleiben. Keine Übung oder Lektion kann gut sein, wenn sie mit Taktfehlern verbunden ist und kein Ausbildungsschritt kann richtig sein, wenn er zu Taktfehlern führt.
Vom Drunter zum Runter! Dressurreiten ist Bewegung, ist Dynamik. Nur so entsteht das Runde. Die Bewegung der HB erzeugt das Runde. Also ist die Bewegung ursächlich für die Haltung. Haltung ist Statik. Damit schafft die Dynamik die Statik. Rücken und Hals über den Schub der HB zum Arbeiten bringen. Dressurreiten ist Bewegung mit den zugehörigen Haltungen. Diesen Zusammenhang immer wieder durch ‚Zügel aus der Hand kauen' überprüfen. Das prüft nicht nur, sondern schult auch und verbessert nebenbei die Dehnungsfähigkeit d. P. Das stellt letztlich die Losgelassenheit dar. Die Losgelassenheit ist erreicht, wenn d. P. bereit ist, in allen drei Gangarten seinen Hals nach vorwärts abwärts zu dehnen. Das losgelassene P. geht mit schwingendem Rücken und natürlichen taktmäßigen Bewegungen, ohne zu eilen, vorwärts. Der Reiter kommt zum Treiben und kann geschmeidig sitzen. Merkmale: zufriedener Gesichtsausdruck (Auge, Ohr), gleichmäßig schwingender Rücken, geschlossen tätiges Maul, getragener, synchron zur Bewegung pendelnder Schweif, Abschnauben als Zeichen der inneren Entspannung und das Loslassen des Brustkorbes (P. kommt zum Atmen im Bewegungsrhythmus und nimmt durch die Entspannung der Rippen den Reiterschenkel an, der dadurch besser einwirken kann.)
Zusammenfassend gilt also: Der Reiter treibt d. P. in seinem individuellen Tempo, zuerst das natürliche (Lösungsphase/Gewöhnungsphase) dann das Arbeitstempo (Arbeitsphase/Entwicklung der Schubkraft). Durch die richtige Tempowahl entstehen Takt und Gleichgewicht. Das Pferd braucht also seine Muskulatur nicht mehr, um sich mit dem Reitergewicht zu stabilisieren, sondern es kann sie für die Bewegung frei geben. Es kann sie loslassen. Takt und Losgelassenheit erzeugen die Voraussetzungen für die Anlehnung, die in ihren Anfängen aber währenddessen schon simultan entsteht. Kontakt zum Maul, der dann zur Anlehnung wird, ist notwendig, damit das Pferd vorne eine Begrenzung/ „Information" findet. Anlehnung ist die stete, weich federnde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Die A. wird vom P. gesucht und vom Reiter gestattet. Die jeweils richtige A. gibt dem P. die nötige Sicherheit, sein natürliches Gleichgewicht unter dem Reiter wiederzufinden und sich im Takt der verschiedenen Gangarten auszubalancieren. Das Genick ist immer der höchste Punkt, außer wenn vorwärts abwärts in Dehnungshaltung geritten wird. Die A. darf niemals durch Rückwärtswirken mit den Zügeln bewirkt werden; sie muss das Ergebnis der richtig entwickelten Schubkraft sein. Das Pferd muss infolge der treibenden Einwirkung vertrauensvoll an die Hand herantreten.
Hinten drunter, vorne runter! Durch das Untertreten der HB und den dadurch erzeugten Schub, der am Gebiss seine Begrenzung findet, kommt d. P. zu einer passiven, rein knöchernen Aufwölbung der WS, die den Reiter trägt, ohne dass die langen Rückenmuskeln daran beteiligt sind. Diese können schwingen, lassen den Reiter zum Sitzen kommen und sind später Teil der Schwungentfaltung. Beim Dehnen des Halses ist entscheidend, dass d. P. die Ganasche öffnet. Das signalisiert dem Reiter das Abspannen der Beuger des Unterhalses. Das ist die erste Ausprägungsstufe der Anlehnung: Mit offener nachgebender Ganasche den Zügel annehmen. Alle weiteren Steigerungen der Anlehnung sind eine Funktion der Aktivität und der Arbeitsweise der HH. Damit werden sie vom Verhältnis der Schub- zur Tragkraft bestimmt. Die Anlehnung ist das Ergebnis richtig entwickelter Schubkraft - durch treibende Einwirkung vertrauensvolles Herantreten an die Hand des Reiters. Das nächste Ziel ist über das Gleichgewicht zur Selbsthaltung, d. h., d. P. sucht bei sicherer weicher Verbindung mit der Hand keine Stütze mehr in derselben. Zu keinem Zeitpunkt darf es dabei eine leere Verbindung geben. Bewegungen im Gleichgewicht ergeben Selbsthaltung als 2. Stufe der Anlehnung. Die 3. Stufe ist die Beizäumung. In Stufe 2 liegt der Schwerpunkt des Systems Reiter und Pferd in etwa unter dem Knie des Reiters. Die Beizäumung (vertikale Biegung im Genick, P. steht am Zügel) ergibt sich aus der beginnenden Versammlung. Dabei wandert der Schwerpunkt etwas zurück. Es kommt zum Beginn des Beugeganges. Die Schubkraft wird zugunsten der Tragkraft gemindert. Die Anlehnung wird bei gleicher Sicherheit leichter. Die Ganasche schließt sich optisch, bleibt funktionell aber offen. Die Unterhalsmuskeln bleiben abgespannt, was den Ohrspeicheldrüsen ermöglicht, sich unter den Atlasflügel zu schmiegen oder aber als Wulst hervorzutreten, ohne gedrückt zu werden, je nach Anatomie. Ist die Versammlung erreicht und gefestigt, besteht die Fähigkeit eines dauerhaften Beugeganges aus den Hanken heraus, die die Last aufnehmen und tragen. Damit entsteht die relative Aufrichtung als feinste Form der Anlehnung. Nur in dieser Phase geht d. P. durchs Genick. In relativer Aufrichtung stehen die HWK senkrecht aufeinander, ohne muskulär gestützt zu sein. Dies ist ein rein passiver Vorgang, der sich analog dem der Aufrichtung der Rückenwirbelsäule abspielt. Die Halsmuskulatur wird für die Arbeit frei. Der Kopf-Hals-Arm-Muskel spannt sich nun erwünschterweise an. Das erleichtert die Vorhand zusätzlich, verstärkt die Bergauftendenz und erhöht die Schulterfreiheit. Erkennbar wird dies an der nicht mehr gebogenen Unterhalskontur. Im Idealfall steht diese nun annähernd senkrecht. Die Oberlinie des Halses zeigt nun einen Viertelkreisbogen. Dabei sieht die Muskulatur wie in Marmor gehauen aus, da der Träger des Halses, der M. semispinalis capitis, die statische Arbeit praktisch alleine verrichtet. Zusammenfassend ist festzustellen: Nur in der Versammlung bei relativer Aufrichtung tritt d. P. durchs Genick, solange die Schubkraft überwiegt, geht d. P. durch die Ganasche!
Nach Erreichen und Sicherstellen von Takt, Losgelassenheit und Anlehnung ist die Lösungsphase abgeschlossen.
Teil II vom 06.11.2004
In der Arbeitsphase geht es um die systematische Schulung und Verbesserung der Bewegung. Entscheidende Begriffe sind: Schwung, Geraderichtung und Versammlung. Dabei darf Schwung keine Frage des Tempos sein. Er ist vielmehr eine Funktion des Vorwärts. Dabei meint Vorwärts energisches aber angemessenes Treiben, das die Bewegungsqualität der HH verbessert. Auch die Seunigdefinition (vor den Hilfen sein) trifft zu. Die zu wählenden Tempi sind an der Anatomie d. P. zu orientieren. Kenngrößen: Engagement der HH und positive Grundspannung der Muskulatur (Arbeitsbereitschaft und -fähigkeit) führen zu elastischen Bewegungen. Schwung ist das Ergebnis reiterlicher Ausbildungsarbeit, die zwar den natürlichen Gang des Pferdes nutzt, ihm aber die Eigenschaften Losgelassenheit, Schub aus der Hinterhand und Durchlässigkeit hinzufügt. Zur Schwungentwicklung in den einzelnen Gangarten immer in beide Richtungen arbeiten. Also bei der Entwicklung des Mitteltrabes über Tritte verlängern auch den abgekürzten Arbeitstrab hin zum versammelten Trab immer wieder andeutungsweise reiten. Diese Abwechslung ist mental angenehm für d. P. und verbessert Takt, Fleiß und Raumgriff. In den verstärkten und starken Gangmaßen wird die Rahmenerweiterung durch den wachsenden Schub erzeugt. Das ist kein Dehnen! Der Reiter bestimmt über die Anlehnung, welche er gewährt, das Maß der Rahmenerweiterung. Dabei wird die Anlehnung regelmäßig voller. Dieser Zusammenhang macht klar, warum der Mitteltrab die ultimative Prüfung der Korrektheit des Ausbildungsganges ist. Ein schwungvoll gerittener MT, der in Übereinstimmung mit dem Gebäude d. P. steht, beweist die richtig entwickelte und kontrollierbare Schubkraft der HH, deren Fähigkeit zur Schwungentfaltung sowie ihr beginnendes Versammlungsvermögen. Zuerst steht der Takt, der auch unter diesen erschwerten Bedingungen rein und konstant bleiben muss. Bei mangelhafter Losgelassenheit ist ein fließender harmonischer Bewegungsablauf undenkbar. Die anlehnungsbezogene Rahmenerweiterung zeigt, dass d. P. korrekt an den Hilfen steht und bereit ist, dem Gebiss zu folgen. Der schwingende Rücken, der den Reiter nicht nur sitzen lässt, sondern ihn mitnimmt, überträgt den energischen Impuls aus der HH auf die gesamte Vorwärtsbewegung d. P. Dieses fußt energisch ab und schwingt in der durch die Schwungentfaltung verlängerten Schwebephase gut nach vorne durch. Keinesfalls darf die Schwebephase durch ein Verkürzen erzeugt werden. Treten in Schmalspur bei Hufschlagdeckung zeigt fortgeschrittene Geraderichtung. Eine im Ansatz gut erkennbare Bergauftendenz zeugt von mindestens beginnender Versammlungsfähigkeit. Damit überprüft der MT das bisherige Ausbildungsergebnis unter allen Aspekten der Skala der Ausbildung. Nicht für alle erfreulich ist der Umstand, dass der MT auch deutlich das Vermögen des Ausbilders, seinen Kenntnisstand und sein Verständnis der Ausbildungsskala dokumentiert. Präsentiert d. P. diese Aufgabe nicht mit der erforderlichen Qualität, sind Fragen nach der Kompetenz des Ausbilders berechtigt, besonders wenn er es selbst reitet. Das Geraderichten dient der Überwindung der Folgen der natürlichen Schiefe (nS) und stellt eine der schwierigsten aber auch eine der wichtigsten Klippen in der Ausbildung d. P. dar. Sie hat nichts mit der Lage des Fohlens im Mutterleib zu tun, sondern ist analog der Rechts- und Linkshändigkeit des Menschen zu verstehen. Damit ist sie Teil der spezifischen Hirnorganisation der Säugetiere und stellt bei Herdentieren wahrscheinlich einen Überlebensmechanismus dar. Weiter bestehen Hinweise, dass sie Folge eines primitiven, automatisierten Bewegungslernens ist, das schon im Mutterleib beginnt (Udo Bürger). Die Tatsache, dass die Vorhand schmaler ist als die HH, begünstigt die nS weiter. Den Reiter behindert sie, weil d. P. einen Hinterfuß, meist den rechten (die überwiegende Mehrzahl d. P. ist Rechtshänder), nach innen am Trittsiegel des gleichseitigen Vorderfußes vorbei setzt. Es ist damit von hinten rechts nach vorne links schief. Dadurch wird der linke VF vom rechten HF ungenügend gestützt. Das merkt der Reiter daran, dass d. P. ihm links erheblich mehr Gewicht in die Hand legt als rechts. Es strebt einen Gleichgewichtsausgleich auf dem linken Zügel an. Dieses Aus-der-Spur-treten hat seine Ursache in der Rechtsbiegung der meisten Pferde (hohle oder auch schwierige Seite). Deswegen fällt es den Pferden schwer, in Wendungen nach links die linke Seite hohl zu machen, d. h. die Muskulatur abzuspannen und sich dem Hufschlag durch Biegen der linken Seite anzupassen. Weiter bleiben sie in der Ganasche steif und setzen dem linken Zügel durch Verschieben des Unterkiefers nach links weiteren Widerstand entgegen. Sie versuchen also insgesamt rechtsgebogen hohl zu bleiben, die Wendung in einer Art fehlerhafter „Konterstellung" abzuschreiten (schrägelnde mangelhafte Rechtstravers-Stellung). Trotzdem gehen sie willig in die Linkswendung, während sie der Rechtswendung je nach Ausmaß der nS z. T. erheblichen Widerstand entgegensetzen. Dabei geben sie dem Zügelanzug rechts willig nach. Dies ist aber nur ein scheinbares Eingehen auf den Wunsch des Reiters. Tatsächlich nimmt es den rechten Zügel nicht an. Wird d. P. im rechten Zirkel nicht eiliger, sondern verhält sich und verweigert zuletzt das Vorwärtsgehen, wobei es im linken Zirkel abschiebt, im Tempo zulegt und sich vermehrt auf den linken Zügel stützt, sind das ernste Zeichen, dass sich die Schiefe verschlechtert, weil der Reiter, anstelle von der Hinterhand her, versuchte, sie vorne mithilfe der Zügel zu überwinden. Spätestens jetzt muss d. R. anfangen, von hinten her zu arbeiten. Berücksichtigen muss er dabei, dass die nS zur Überlebensausstattung d. P. gehört. Weiter muss er davon ausgehen, dass das Rechtsherum (dem natürlichen Drall entgegen) empfindliche Gleichgewichtsstörungen auslösen kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass d. P. dabei Empfindungen hat, die dem menschlichen Schwindel ähnlich sind. Zumindest legen einzelne, besonders heftige Reaktionen diese Vermutung nahe. Das heißt, die gerade richtende Arbeit hat eine nicht zu unterschätzende psychologische Komponente, die der denkende Reiter sich aber auch zunutze machen kann.
Das schiefe P. fällt auf der einen Hand in die Wendung (links) auf der anderen (rechts) drängt es aus ihr heraus. Links Zirkel verkleinern und rechts erweitern sind die leichten Übungen; rechts verkleinern und links erweitern sind die schweren. Das schiefe P. setzt d. R. schief hin. Da die meisten P. rechts schief sind, setzten sie d. R. rechts tiefer. Der erfahrene R. tritt vermehrt den linken Bügel aus und bleibt gerade sitzen. Der Unerfahrene macht das Gegenteil und verschiebt dadurch den Sattel nach rechts. Besonders beim Leichttraben hat er das Gefühl, der linke Bügel sei zu kurz, weswegen er ihn um ein bis zwei Loch verlängert. Damit kommt sein Gesäß zwar wieder in die Mitte des Pferderückens, zum Ausgleich der unterschiedlichen Bügellängen muss er nun aber in der rechten Hüfte einknicken und gewöhnt sich einen schiefen Sitz an, welcher seinerseits die Schiefe d. P. steigert. Umgekehrt wäre die wichtigste Maßnahme, den Bügel auf der konvexen (steifen) Seite auszutreten, weil das die Beseitigung der Schiefe wesentlich fördert. Sieht ein RL seinen RS mit Knick in der rechten Hüfte schief sitzen, weiß er, dass d. P. sehr schief ist. Seine Anweisungen müssen also die Geraderichtung d. P. betreffen und diese verbessern. Korrekturen am Sitz verfehlen in dieser Phase ihren Zweck. Dabei soll der RS darauf achten, dass die Bügelstütze beiderseits gleich bleibt. Hat der linke Bügel die Tendenz gegen den Absatz zu rutschen, ist d. P. noch nicht gerade. Ein sehr sicheres, aber wenig beachtetes Zeichen.
Wie richtet man sein Pferd nun gerade? Eine Zusammenstellung aus den Richtlinien, Steinbrecht, Bürger, Seunig, Podhajsky und Hübener. In dieser Übersicht werden zunächst die Aussagen der einzelnen Autoren die nS betreffend zusammengefasst, soweit sie das bisherige Bild erweitern und vervollständigen. Es folgen Angaben zum zweckmäßigen Vorgehen. Dabei wird Wert auf ihre Empfehlungen für die tägliche Praxis des Geraderichtens gelegt.
FN-Richtlinien
Band I (27. Aufl., 2000, Seite 172-173): - Geraderichten - Ein Pferd ist gerade gerichtet, wenn HH und VH aufeinander eingespurt sind, d.h., wenn es auf gerader und gebogener Linie mit seiner Längsachse der Hufschlaglinie angepasst ist. Man sagt auch, d. P. geht „hufschlagdeckend". Geraderichtung ist für die gleichmäßige Belastung der beiden Körperhälften erforderlich und wird durch konsequente Gymnastizierung beider Körperhälften erzielt. Die meisten Pferde haben eine angeborene schiefe Körperhaltung, die „natürliche Schiefe". Sie ist, ähnlich wie die Links- und Rechtshändigkeit des Menschen, cerebral bedingt, also angeboren. Sie wird noch dadurch begünstigt, dass die VH schmaler ist als die HH. In den meisten Fällen tritt d. P. mit dem rechten HF seitlich rechts neben die Spur es rechten VF. Das hat zur Folge, dass der rechte HF eine größere Schubkraft entwickeln muss, während auf dem linken HF eine höhere Anforderung in Bezug auf die Beugefähigkeit der Gelenke gestellt wird. Zusätzlich besteht die Gefahr des vorzeitigen Verschleißes auf dem linken Vorderbein. Setzt eine größere Belastung ein, die eine stärkere Beugung der Hinterbeine erfordert, so kann wohl der linke Hinterfuß dieser Forderung nachkommen. Der rechte HF jedoch sucht sich dieser vermehrten Beugung durch ein seitliches Ausweichen von der Spur des gleichseitigen VF zu entziehen.
Demnach muss ein Pferd gerade gerichtet werden und sein, um:
- eine gleichmäßige Belastung zu erreichen bzw. einem vorzeitigen einseitigen Verschleiß der Gliedmaßen vorzubeugen,
- die Schubkraft zu optimieren,
- das Pferd sicherer an den Hilfen zu haben und durchlässig zu machen,
- es gleichmäßig an beide Zügel herantreten zu lassen,
- die Versammlung zu erreichen.
Nur ein gerade gerichtetes Pferd kann auf beiden Händen gleichmäßig durchlässig sein.
MERKE: Bei einem gerade gerichteten Pferd wirkt die Schubkraft der HH voll in Richtung seines Schwerpunktes. Umgekehrt können auch nur dann verhaltende Hilfen des Reiters über Maul, Genick, Hals und Rücken bis zur HH richtig durchkommen und gleichmäßig auf beide Hinterbeine wirken.
Das Geraderichten ist eine immer wiederkehrende Aufgabe und niemals abgeschlossen, da jedes Pferd eine m.o.w. ausgeprägte natürliche Schiefe hat. Vorbedingung für die Versammlung ist die Geraderichtung, wodurch erst eine gleichmäßige Lastaufnahme beider HB gewährleistet wird.
Band II (12. Aufl., 1997, Seite 29-32): - Hinweise für die Weiterentwicklung der Längsbiegung - Durch die systematische Ausbildungsarbeit soll unter anderem erreicht werden, dass die natürliche Schiefe des Pferdes beseitigt wird und beide Hinterbeine genau in Richtung beider Vorderbeine spuren. Einerseits dient das Geraderichten auf Grund der gleichmäßigen Belastung der Gliedmaßen der Gesunderhaltung des Pferdes. Andererseits kann erst dadurch sichergestellt werden, dass d. P. auf beiden Händen gleichmäßig geschmeidig und wendig ist. Um diese Ziele zu erreichen, ist es notwendig, dass sich d. P. stellen und biegen lässt. Wie alle Kriterien der Ausbildungsskala, so müssen auch Stellung und Biegung allmählich und schrittweise erarbeitet und im Laufe der Ausbildung immer weiter verbessert werden.
- Dazu muss der Reiter: Zwischen Stellung und Biegung unterscheiden können,
- in der Lage sein, die Hilfen differenziert und präzise zu geben,
- den jeweiligen Grad der Stellung bzw. der Biegung auf den Ausbildungsstand und die Veranlagung d.P. abstimmen,
- wissen, was bei einem Pferd die „hohle Seite" und die „Zwangsseite" bedeuten,
- erkennen können, mit welchen Ausbildungsschritten und Übungen entsprechend abzustellen sind.
Stellung und Biegung sind unabdingbare Voraussetzungen, nicht nur für das Reiten von Volten, Seitengängen und Pirouetten, sondern auch für das Reiten von einfachen Wendungen. So müssen die Ecken eines Vierecks korrekt als Viertelvolten durchritten werden. Das Abwenden auf die Mittel-, Diagonal- oder Viertellinie erfordert ebenfalls eine entsprechende Biegsamkeit. Außerdem ist das Pferd nur in der Lage, auch im Geradeaus gleichermaßen mit beiden Beinen unter den Schwerpunkt zu treten, wenn es durch die gerade richtende Biegearbeit entsprechend gymnastiziert wurde. Stellung und Biegung sowie das Geradegerichtetsein sind also wechselseitig miteinander verbunden.
Während bei der Stellung das Pferd seinen Kopf im Genick seitlich wendet und der Hals dabei nur geringfügig gebogen ist, gehört zur Biegung des Pferdes sowohl die Stellung als auch die Rippenbiegung, soweit anatomisch möglich.
Merke: Die Biegung, auch Längsbiegung genannt, setzt sich aus der Stellung und der Rippenbiegung zusammen. Dabei soll der Pferdekörper, soweit anatomisch möglich, gleichmäßig gebogen werden. Die Stellung darf also nie größer sein als die Rippenbiegung des Pferdes.
Das Stellen dient in erster Linie zur Vorbereitung auf bestimmte Übungen und Lektionen, die in der Regel eine Längsbiegung oder Richtungsänderung verlangen. Das Stellen überprüft also die Nachgiebigkeit des Pferdes im Genick. Beim jungen Pferd und in der Grundausbildung ist darauf zu achten, dass das Pferd dabei dem inneren Zügel folgt, ohne sich jedoch darauf zu legen. Außerdem muss es vertrauensvoll an den äußeren Zügel herantreten, um dadurch die Muskulatur besonders auf der jeweils „hohlen Seite“ allmählich zu dehnen. Mit fortschreitender Ausbildung und Gymnastizierung kann der Grad der Stellung geringfügig erhöht werden. Der Reiter darf aber niemals versuchen, mit dem inneren Zügel den Kopf so stark seitlich zu wenden, dass dies zu einer Zwangshaltung führt. Dadurch würde nicht die Geschmeidigkeit erhöht, sondern nur das innere Hinterbein blockiert.
Das Biegen des Pferdes kann in der Grundausbildung ebenfalls noch gering sein. Auf dieser Ausbildungsstufe werden in erster Linie große gebogene Linien geritten, die zwar noch keine deutliche, aber doch eine gleichmäßige Biegung d. P. verlangen. Es ist besonders darauf zu achten, dass der innere Schenkel in vortreibender Position für die Rippenbiegung sorgt und der äußere Schenkel verwahrend ein Ausfallen der Hinterhand verhindert.
(...) In der weiteren Ausbildung wird beim Reiten von 8-m- und 6-m-Volten, Traversalen und Galopppirouetten eine gleichmäßige Längsbiegung nur erreicht, wenn d. P. in sich gerade gerichtet ist, also auf geraden wie auf gebogenen Linien spurt und an den jeweils äußeren Zügel herantritt.
Übermäßiges Biegen ist falsch und macht d. P. nicht geschmeidiger, sondern baut im Gegenteil vermehrt Spannung auf. Außerdem wird es häufig mit einem überdeutlichen Stellen, insbesondere in den Seitengängen, verwechselt. Eine zu starke Abstellung im Hals verhindert die verlangte Rippenbiegung und somit die durchgehend gleichmäßige Biegung d. P. in seiner Längsachse. Das Pferd bricht am Widerrist ab.
Übertriebenes Biegen kann auch dazu führen, dass d. P. nicht mehr auf den inneren Schenkel des Reiters reagiert, sondern nur noch seitwärts ausweicht. Dadurch wird der eigentliche Zweck des Biegens verfehlt. Zusätzlich tritt die Gefahr von Verletzungen (z.B. Kronentritt) auf. Es gibt P., die sehr beweglich in der Rippenpartie sind und sich, meistens aber nur nach einer Seite, übertrieben biegen wollen. Die „hohle Seite" ist dann besonders ausgeprägt. Solche P. müssen vermehrt ausbalanciert und in ihrer Geraderichtung gefestigt werden. Stellung und Biegung dürfen zunächst nur geringgradig verlangt werden.
Merke: Entscheidend ist, dass sich der Reiter der jeweiligen Situation, Aufgabenstellung und individuellen Veranlagung d. P. bewusst ist und nur eine allmähliche, systematische Steigerung der Biegung verlangt. Ein P. kann nicht durch grobe Hilfen zur Geschmeidigkeit gezwungen werden.
Um Stellung und Biegung d. P. weiter zu verbessern und in den verschiedenen Anforderungsgraden differenziert reiten zu können, sind insbesondere die Vorübungen zu den Seitengängen wertvoll. Durch das Schultervor und das Reiten-in-Stellung können wesentliche Grundlagen für die weitere Ausbildungsarbeit gelegt werden.
Gustav Steinbrecht „Gymnasium des Pferdes“ (15. Aufl., 2004)
Seite 77 ff. – „Als erste Hauptgrundsätze der Kunst rufe ich einem jeden Reiter zu:
„Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade!“
Unter diesem Vorwärtsreiten verstehe ich nicht ein Vorwärtstreiben des Pferdes in möglichst eiligen und gestreckten Gangarten, sondern vielmehr die Sorge des Reiters, bei allen Übungen die Schubkraft der Hinterbeine in Tätigkeit zu erhalten, dergestalt, dass nicht nur bei den Lektionen auf der Stelle, sondern sogar bei Rückwärtsbewegungen das Vorwärts, nämlich das Bestreben, die Last vorwärts zu bewegen, in Wirksamkeit bleibt. Man befähige das Pferd durch Übung, seine Schubkraft durch Belastung bis zum Äußersten zu beschränken, man unterdrücke sie aber niemals durch Überlastung! (Man beachte die präzise Definition des „Vorwärts“ von GS! Anm. d. Verf.) Ferner verstehe ich unter der geraden Richtung des Pferdes nicht seine völlig ungebogene Körperhaltung, sondern eine derart vorwärts gerichtete Einstellung seiner Vorhand auf die abzuschreitenden Linien, dass es unter allen Umständen, selbst bei stärkster Biegung seines Körpers und in den Lektionen auf zwei Hufschlägen, mit seinen Vorderfüßen den Hinterfüßen voranschreitet, die ihrerseits wiederum jenen unbedingt folgen, indem sie stets in der Bewegungsrichtung vor und niemals seitwärts dieser Richtung treten. – Durch außer Acht lassen dieser beiden goldenen Regeln aus Unkenntnis oder Nachlässigkeit entstehen in der Dressur alle Fehler, die das Pferd widersetzlich machen und oft sogar zugrunde richten.“
Seite 109 ff. - ... , und fasse am Schluss des Kapitels ihre Grundregeln nochmals kurz zusammen, indem ich zunächst daran erinnere, beim Biegen nicht, wie dies so häufig geschieht, den äußeren Schenkel und inneren Zügel, sondern umgekehrt den inneren Schenkel und äußeren Zügel vorherrschend wirken zu lassen. Diese Hilfen müssen die richtige Haltung des ganzen Körpers, also die gleichmäßige Verteilung der Gewichtsmasse auf alle vier Beine herbeiführen, indem der innere Schenkel das innere Hinterbein dadurch belastet hält, dass er es gegen das äußere treibt, und der äußere Zügel durch seine Wirkung nach innen die Schultern stets so viel nach der gebogenen Seite hin richtet, dass sie der Hinterhand richtig vorgerichtet sind, wodurch das innere Vorderbein belastet bleibt. Ausfallen der Kruppe nach außen vermindert oder hebt die beabsichtigte Biegung zwar mehr oder weniger auf, hinterlässt aber keinen bleibenden, nachteiligen Einfluss, da es dem Pferde nicht die Mittel lehrt, sich durch falsche Biegung zu entziehen. Dies geschieht aber, wenn das Pferd durch zu starke Wirkung des äußeren Schenkels und inneren Zügels in eine schiefe Richtung versetzt wird, wenn also die Hinterhand so gegen die Vorhand gerichtet ist, dass nicht mehr beide Hinterbeine gleichmäßig in Richtung der Schultern wirken. Auf diese Regeln bezüglich Einrichtung von Vor- und Hinterhand und der anderen, dass die Hinterbeine unter allen Umständen ihre ungeschwächte Kraftäußerung nach vorwärts ausüben müssen, beruht eigentlich die ganze Reitkunst.
Udo Bürger „Vollendete Reitkunst“ (5. Aufl., 1982)
Seite 102 – 109. Kann entfallen, da auf Seite 4 dieses Skriptums das Wesentliche der Aussagen von UB zusammengefasst ist.
Waldemar Seunig
(„Von der Koppel bis zur Kapriole“ (Ausgabe Berlin 1943/Olms 1996) Sehr empfehlenswert, allerdings sind die entscheidenden Stellen über das gesamte Werk verteilt.)
„Reitlehre von heute“ (5. Aufl. 1978) Seite 168 - 170
Geraderichten heißt, die Vorhand so auf die Hinterhand einrichten, dass das Pferd, wenn es auf einem Hufschlag geht, sich stets mit seiner Längsachse der Hufschlaglinie anpasst, gleichviel ob diese gebogen oder gerade ist. Der Schub der HH kann nur dann voll und in gerader Richtung gegen die Vorhand wirken. Der Geraderichtung steht die fast allen Pferden gemeinsame Neigung zur so genannten nS Schwierigkeiten entgegen. Meistens ist es das rechte Hinterbein, welches das Pferd nur widerstrebend in gerader Richtung vorwärts gegen den Schwerpunkt unter den Leib zu setzen vermag. Dadurch, dass es mit diesem HF nach rechts seitwärts ausweicht, neigt es zum Ausfallen mit der diagonal gegenüberliegenden Schulter und einer nach außen gewölbten Ausbuchtung der linken Halsseite. Infolgedessen geht es gegen den rechten Schenkel und linken Zügel. Es bietet das Bild eines in mangelhafter Rechtstraversstellung schrägelnden Pferdes.
Um ein solches Pferd gerade zu richten, muss die linke Schulter mit dem tiefer geführten linken Zügel verwahrt und die Vorhand mit dem rechten, öffnenden Zügel nach rechts geführt werden, sodass der rechte VF vor das rechte Hinterbein gerichtet wird. Beide Schenkel, vorherrschend der rechte, treiben an den rechten Zügel heran, dem das Pferd ausweichen will. Auch diese Korrektur hat in sehr lebhaftem Arbeitstrab zu geschehen. Ein Zurechtbiegenwollen mit linker Hand und rechtem Schenkel in matten Gängen würde das Pferd nur noch schiefer machen. Abwechselnd mit diesem entschiedenen Arbeitstrab wird auch der Kontergalopp auf der linken Hand, so, als wollte man mit der VH in die Wand hineinreiten, einer Geraderichtung außerordentlich förderlich sein.
Wie ein roter Faden soll sich durch die ganze gerade richtende Arbeit der Gedanke ziehen, dem zum Beispiel von rechts nach links schiefen Pferd seine Hauptstützen des Widerstandes, den rechten HF und die linke Schulter, zu „rauben" und sie zur Losgelassenheit zu bringen. Das kann ich mit Geduld und Sitz im frischen Arbeitstrab auf dem Zirkel linker Hand in 10 bis 60 Minuten jedem Pferd und wäre es schief, wie der Turm von Pisa, besorgen: Linker Zügel, auf den sich die auf dem Umweg über linke Ganasche und Maul ausfallende Schulter stützen möchte, ganz locker. Rechter Zügel unter allen Umständen weich, aber zäh am Maul bleibend, selbst auf die Gefahr hin, dass ich lange Viertelstunden mit verkehrter Kopfstellung reite. Der linke Schenkel treibt, knapp hinter dem Gurt, erweiternd (und dadurch die rechte Schulter vor das rechte, ausfallende Hinterbein bringend) nach außen. Diese Arbeit kostet Schweiß und noch manches andere. Aber das erste Kopfschütteln des Pferdes, als Morgenrot sich anbahnender Entkrampfung, ist dieses Schweißes wert.
In den Bereich des Geraderichtens fällt auch das Verwerfen im Genick (Verlehnen), dessen sichtbarstes Zeichen das Tiefertragen eines Ohres ist. Die Ohren werden in ungleicher Höhe getragen, weil sich eine Ohrspeicheldrüse unter, die andere über den Ganaschenrand fügt, da die Hinterbeine nicht gleichmäßig herantreten.
Die meisten, nicht die Meister, greifen da zu Symptomkuren, indem sie mit einer Hand höher führen oder kreuzweise unter dem Hals ausbinden – schade um jedes weitere Wort. Korrektur mit Dauererfolg: Zuerst im lebhaften Arbeitstrab lösen, indem man zum Dehnen bringt. Dann vorsichtig den Winkel Kopf-Hals soweit schließen, dass sich beide Ohrspeicheldrüsen entweder unter oder über die Ganaschenränder fügen. Dann nimmt das Pferd, solange die HH auf die VH gerichtet bleibt, auch beide gleichmäßig Zügel an.
In „Am Pulsschlag der Reitkunst“ ist die Darstellung kürzer, sonst aber identisch (S. 31).
Alois Podhajsky: „Die klassische Reitlehre“ (Neuauflage 1998, Stuttgart)
Seite 41: Alle Pferde, die gebäudebedingt im Gleichgewicht sind, gehen unbelastet durch das Reitergewicht praktisch gerade. Erst unter der Last des Reiters und besonders bei der Arbeit in der Bahn, kommt es zum Schiefgehen. Podhajsky sieht die wesentliche Ursache in der unterschiedlichen Breite von Schultern und Hüften. Das junge Pferd neigt dazu, Schulter und Hüfte gleichweit von der Wand zu halten, um sein Gleichgewicht wiederzufinden, wodurch es schief wird. Notwendig ist das Geraderichten, um die HH gymnastizieren zu können und um in der Folge eine korrekte Versammlung zu entwickeln. Entscheidend ist für Podhajsky auch, dass durch das Geraderichten Gleichgewicht und Geschmeidigkeit nicht nur gefördert werden, sondern im reiterlichen Sinne erst ermöglicht werden. Seite 97: Gerade gerichtet wird durch das Einstellen der VH auf die Nachhand, was an der Bande leichter gelingt, da diese dem Pferd hilft. Die VH wird mit beiden Zügeln von der Bande abgeführt und vor die HH gerichtet. Nur so entsteht Gleichgewicht. Im Vorwärts bleiben, keinen Taktverlust, Tempo darf nicht schleppen. Auf der steifen Seite ist die Arbeit leichter, da das Pferd hier den Zügel annimmt. Auf der hohlen Seite wird es versuchen, durch übermäßiges Nachgeben im Hals („Abbrechen“ am Widerrist) der Anforderung des Reiters scheinbar zu folgen und damit gleichzeitig die echte Rippenbiegung zu vermeiden. „Abdrücken“ mit dem äußeren Zügel, um es zu veranlassen, nicht nur den Hals sondern die VH hereinzustellen, schafft Abhilfe (siehe Anhang).
Weiter verteilen sich viele Anmerkungen zur Geraderichtung über das ganze Werk, die immer wieder betonen, wie wichtig das Geraderichten für das richtige Gehen und den richtigen Ausbildungsgang ist. Interessant ist noch der Hinweis, dass das Schiefwerden vom Pferd als Verteidigungsmittel gegen lästige Anforderungen aber auch gegen Überforderungen genutzt wird, was sich vom Ausbilder als sehr sensible Frühwarnung in der Arbeit nutzen lässt.
Eberhard Hübener: „Schmeichelnder Sitz, atmender Schenkel, flüsternder Zügel“ (Originalausgabe 1999, Hildesheim) Kapitel „Das 1x1 des Geraderichtens“ (Seite 29 – 41)
Faustregeln: Auf der Problemseite (= schwierige S. = falsch hohlgebogene S. = konkave S.) nimmt das Pferd den Zügel nicht an, schiebt es den Schenkel des Reiters nach vorne (es geht gegen den Schenkel) und setzt den Reiter tiefer (bedingt dessen Einknicken in der Hüfte). Auf der Zwangsseite (= aufgewölbt = konvex = falsch gedehnt = mit festgehaltenen, übermäßig angespannten, nicht zwanglos gefügigen Halsmuskeln) geht das Pferd gegen den Zügel und fällt über die Schulter aus. Die nS ist mit einer falschen, dem Drall (der bevorzugten Bewegungsrichtung) entgegengesetzten Längsbiegung verbunden. Das Pferd geht nicht gern in die Richtung, in die seine falsche, aus der nS resultierende Längsbiegung weist. Und es will nicht den Galopp gehen, der für eine Wendung mit dieser Längsbiegung prädestiniert scheint. Der zur gewölbten Zwangsseite weisende Drall ergibt sich daraus, dass das Pferd sein geschickteres, besser bemuskeltes, kräftigeres Vorderbein auf der hohl gebogenen Problemseite hat. Aus dem größeren Raumgriff dieses Vorderbeins resultiert die Wendung in die Zwangsseiten-Richtung. Außerdem kann es als kräftigeres VB auch der in der Wendung verstärkt wirkenden Zentrifugalkraft besser Stand halten (siehe auch S. 32 über den Galopp). Händigkeit und Drall sind keine Marotte, sondern im Sinne des Heimfindevermögens für Herdentiere überlebenswichtig. Wichtig ist seines Erachtens auch der Hinweis Bürgers auf den Zusammenhang von Drall und Gleichgewicht. Danach sind Pferde mit sehr starkem Drall besonders labil in ihrem Gleichgewicht. Möglicherweise stellen sich beim Pferd schon Gleichgewichtsstörungen ein, wenn wir es zwingen, uns in nicht drallkonformer Richtung zu folgen (S. 33-34!). Über die Notwendigkeit zur Geraderichtung besteht Einigkeit. Solides Wissen und Geduld sind Erfolgsgaranten, jede Gewalt unsinnig. Hier, noch viel mehr als sonst, kommt es darauf an, dem Pferd begreiflich zu machen, es verstehen zu lassen, was es tun soll, muss es doch einen Überlebensinstinkt überwinden, um selbst im Beginn der Ausbildung in beide Richtungen geritten werden zu können. Hübeners Vier-Stufen-Programm: 1. Durch Gewöhnen das Pferd den Drall vergessen lassen (S. 34-35). 2. Das Pferd gerade richten und die Muskulatur des schwächeren Beinpaares damit weiter stärken. 3. Um vertrauensvolle, gleichmäßige Anlehnung an beide Zügel werben. 4. Das schwächere diagonale Beinpaar mit speziellen Übungen gymnastizieren. Zu den Übungen im Einzelnen siehe Seiten 35 - 41.
Zum Abschluss des Komplexes ‚natürliche Schiefe und Geraderichten‘ sei noch an Wilhelm Blendinger erinnert, der in seinem Werk „Psychologie und Verhaltensweisen des Pferdes“ eine vorzügliche Darstellung dieses Themas gibt. Besonders wertvoll deswegen, weil sie neben der wissenschaftlichen Schilderung, viele Hinweise für die Praxis enthält. Dabei werden Renn-, Reit- und Fahrpferde gleichermaßen mit einbezogen (4. Auflage, 1980, Seite129 – 144).
Teilweise wörtlich, teilweise sinngemäß dem Band I der FN-Richtlinien entnommen: Die Versammlung zeichnet sich aus durch: vermehrtes Schließen der Gelenkwinkel von Hüft- und Kniegelenken = vermehrte Hankenbeugung; vermehrtes Herantreten der HH an den Schwerpunkt (Untertreten in Richtung des Schwerpunktes); die durch den Beugegang der HH bei vermehrter Lastaufnahme der HH erzeugte relative Aufrichtung in Selbsthaltung mit deutlicher Bergauftendenz. Sie wird nur durch den richtigen Aufbau der Ausbildung und geduldige, zielstrebige Arbeit erreicht. Das Reiten von Übergängen auf geraden und gebogenen Linien verbessert die Geraderichtung und die Versammlungsfähigkeit der HH. Die durch vermehrtes Treiben erzeugte Steigerung der Schubkraft wird nicht, wie beim Zulegen, durch eine nachgebende Hand herausgelassen. Sie wird vielmehr mit durchhaltenden oder annehmenden Zügelhilfen abgefangen, über den durchlässigen Rücken in die HH zurückgegeben, wodurch eine erhöhte Tragkraft erreicht wird. Der Reiter muss besonders darauf achten, dass das Abfangen mit den Zügelhilfen so gefühlvoll und geschickt gehandhabt wird, dass dabei die Hinterbeine nicht am Durchschwingen gehindert werden. Alle Übungen, die die HH zum vermehrten Tragen anregen, sind versammelnde Lektionen. Hierzu zählen vor allem korrekt gegebene halbe und ganze Paraden. Ob eine Lektion als „versammelnde" oder als „versammelte" bezeichnet wird, hängt von der Perfektion der Ausführung ab. In der Grundausbildung wird zum Beispiel das Rückwärtsrichten zunächst versammelnd geritten. Dabei kann das Pferd etwas tiefer eingestellt sein, um vermehrt über den Rücken treten zu können. In der fortgeschrittenen Ausbildung soll das Pferd bei vermehrter Aufrichtung in Selbsthaltung rückwärts treten. Dann ist dies die versammelte Lektion.
Kadenz bedeutet, dass die Schwebephase vom Pferd etwas deutlicher ausgehalten wird. Die Hinterbeine müssen dabei gut nach vorne durchschwingen. Sie ist also eine Funktion des Schwunges und der Versammlung. Erfolgt die Schwebephase ohne das Durchschwingen der HH nach vorne, entstehen die fehlerhaften Schwebetritte, bei festgehaltenem Rücken.
Relative Aufrichtung: Sie ist die Höhe der Anlehnung und steht in direkter Beziehung zum Versammlungsgrad. Ein am Zügel gehendes Pferd geht in relativer Aufrichtung, auch wenn die HH weniger belastet ist und das Pferd sich mit verhältnismäßig langem wenig erhobenem Hals zeigt. Bei stärkerer Belastung der HH, also bei zunehmender Versammlung, wird die VH entsprechend entlastet. Die HH senkt sich wegen der zunehmenden Beugung von Hüft- und Kniegelenken. Das Pferd erscheint dadurch aus der Schulter heraus größer, also insgesamt etwas bergauf. Diese Hals- und Aufrichtungsformen ergeben sich bei richtiger Ausbildung von selbst. (Dagegen steht als fehlerhaft die so genannte absolute Aufrichtung, die überwiegend mit der Hand herbeigeführt wird. Dabei trägt sich das Pferd nicht selbst, sondern Kopf und Hals werden von der Hand des Reiters getragen, die Rückentätigkeit ist gestört und die Aktivität der HH eingeschränkt.) Bei ausreichend entwickelter Tragkraft ist das Pferd also in der Lage, sich trotz des Reitergewichtes in allen Gangarten ausbalanciert in Selbsthaltung zu bewegen. Zur Überprüfung wird mehrere Tritte oder Sprünge übergestrichen. Die Selbsthaltung bleibt bei korrektem Reiten erhalten (Muss!).
Durchlässigkeit ist die entscheidende Eigenschaft des gerittenen Pferdes!
Die Durchlässigkeit ist das Ergebnis der gymnastizierenden Arbeit. Ihr Vorhandensein gibt die schlüssigste Auskunft über den wirklichen Wert der geleisteten Ausbildungsarbeit. Die Durchlässigkeit ist mit den übrigen Kenngrößen der Ausbildungsskala eng verknüpft und steht mit ihnen in einem Wechselspiel:
- Zuverlässige Taktsicherheit in den drei GGA, besonders bei allen Übergängen, wird dem Pferd erst mit zunehmender D. möglich sein. TAKT
- Nur bei einem losgelassen gehenden Pferd kann der Impuls aus der HH durch das ganze Pferd hindurchgehen. Verhaltende Zügelhilfen können vom Maul durch das Genick über den Hals und den Rücken auf die HH wirken. LOSGELASSENHEIT
- Jedes Anlehnungsproblem, also Unsicherheiten oder Starrheiten in der Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul, beeinträchtigt direkt die Durchlässigkeit. ANLEHNUNG
- Ein schwungvoll gehendes Pferd, welches aus dem losgelassenen Rücken heraus mit den HB durchschwingt, wird für die treibenden und verhaltenden Hilfen durchlässiger sein. SCHWUNG
- Erst mit zunehmendem Geradegerichtetsein kann ein Pferd auf beiden Händen gleichmäßig auf Paraden reagieren, dank der gleichzeitig vortreibenden Hilfen an die Hand des Reiters vermehrt herantreten, ohne mit der HH seitlich auszuweichen. GERADERICHTUNG
- Dieses wiederum ist die unabdingbare Voraussetzung für die Versammlung und die daraus resultierende Aufrichtung des Pferdes. VERSAMMLUNG
- Nimmt das Pferd die versammelnde Arbeit an, treten beide HB gleichmäßig in Richtung des Schwerpunktes und sind sie zur vermehrten Lastaufnahme bereit, dann ist die DURCHLÄSSIGKEIT in hohem Maße erreicht.
Geraderichten, Versammlung und Durchlässigkeit sind bei aller Ausbildung und bei aller Nutzung als Reitpferd notwendig. Dabei ist der Grad, wie weit diese Ziele verwirklicht sein müssen, abhängig vom Maß der Belastung des Pferdes und den Anforderungen, die der Reiter an das „Gehen“ des Pferdes stellt. Je höher diese sind, desto kompromissloser muss der Reiter diese Umsetzung in der Praxis anstreben. Das heißt nicht, dass es gestattet wäre, infolge der geforderten Kompromisslosigkeit dem Pferd Gewalt anzutun. Völlig im Gegenteil! Diese Kompromisslosigkeit ist eine Verpflichtung, das Obligo des denkenden Reiters! Er hat seine Ausbildungsarbeit so seriös zu gestalten, dass diese Ziele reell verwirklicht werden, ohne das Pferd mehr zu inkommodieren als unbedingt notwendig.
Vortrag Dr. M., Münzenberg, 16.02.2002
„Richtlinien stellen Ideal dar." - Entscheidend ist der richtige Weg der Ausbildung, angemessene Zwischenstufen als ‚Vorziele'. Der Reiter muss flexibel reagieren, ohne Prinzipien zu verletzen. ‚GEWALT BEGINNT DA, WO WISSEN ENDET!' Was ist (Dressur-) Reiten? Es ist Bewegung mit entsprechenden Haltungen. Zum Beispiel die ganze Parade: Diese kann in korrekter Bewegung über mehrere HP weich von hinten erfolgen. Das Pferd kann aber auch auf die Vorhand geknallt werden. Stand und Haltung können bei beiden gleich sein. Der Unterschied liegt in der Qualität der Bewegung, die zum Halten führt. Korrekte Haltung ist das Ergebnis korrekter Bewegung. Richtige Schulung bildet korrekte Bewegung und verbessert bestehende. SdA gilt für alle Pferde. Ziel: Das im Gehorsam stehende Pferd, das zwanglos und harmonisch auf die Hilfen des Reiters reagiert. Kein Unterjochen, ohne Zwang - aber mit Konsequenz. Vielseitige Gymnastizierung zum Gestalten und Verbessern von Bewegung. Das alles unter Berücksichtigung der Psyche des Pferdes. Bewegung muss gestaltet und verbessert werden, um das Reitergewicht besser tragen zu können. Das Pferd in freier Wildbahn ist dabei kein Maßstab (mehr). Der Mensch ist ethisch verpflichtet, das Pferd zu dem von ihm verlangten Reitdienst zu befähigen. Ziel: Durchlässigkeit! Sie wird um so besser, je besser die Zielgrößen der SdA erreicht wurden. Anatomie: Konstruktion und Aufhängung der Vorhand ausschließlich stützend, die daraus folgende Sitzplatzierung des Reiters ist korrekt. Die Hufe sind vorne rund = stützend, hinten oval = abschiebend. Die Übung ‚Zügel aus der Hand kauen' ist ein sich in den sehnigen Schultergürtel Dehnen, macht Schultern und VB frei; verbessert die Bewegung durch Abspannen des Kopf-Hals-Arm-Muskels und der sonstigen Unterhalsmuskulatur. Schubkraft = Natur, Tragkraft = Ergebnis reiterlicher Arbeit. Das richtige Tempo ist absolut individuell und bestimmt maßgeblich den Takt und seine Qualität. Das Tempo individuell in Maßen variieren - prüfen, ob Bewegung besser wurde. In dieser Weise individuelles Tempo ermitteln und als Ausgangsbasis nutzen. Gleichgewicht bestimmt ebenfalls erheblich den Takt! Große Linien reiten, um das Ausbalancieren zu fördern. Individuelles Tempo ermöglicht Gleichgewicht - beides zusammen ergibt den Takt und bestimmt seine Qualität (Dr. M. meint hier wohl mehr den Rhythmus.) Der Takt muss auf allen Linien, in allen Wendungen und bei allen Übungen erhalten bleiben. Die HP dient zur Steigerung der Durchlässigkeit - mehr positive Spannung unter absoluter Beibehaltung der Losgelassenheit, Genick durchlässiger machen im Sinne von Anlehnung verbessern. „Aufmerksam machen" ist Blödsinn. Schwerpunkt in der Mitte unter dem 15./16. BWK, dessen Dornfortsatz senkrecht steht. Er ist genau unter dem Reiter, an der Stelle, wo der Sattel seinen tiefsten Punkt hat bzw. haben sollte. Dehnungshaltung: v/a - Dehnung wölbt die WS vor dem Schwerpunkt auf; das aktive, abschiebende HB wölbt die WS hinter dem Schwerpunkt auf. Die Anlehnung als Begrenzung vorne und dosiertes Treiben hinten wölbt die WS auf. Diese trägt dann sich und das Reitergewicht völlig passiv. Die Rückenmuskulatur wird frei für die Bewegung und kann schwingen. Rumpfstrecker (vom Genick bis zum Fesselgelenk) = ein System, nur von hinten zu lösen, kann überall fest werden. Lösung muss immer treibend von hinten erfolgen. Alles Andere ist sinnlos, da es gegen die funktionelle Anatomie geht und deswegen vom Pferd nicht geleistet werden kann. Deshalb Dehnung der Strecker. Aber: Spannen der Rumpfbeuger, Unterhalsmuskulatur ausschalten, gerade und seitliche Bauchmuskeln aktivieren. Wegen der Nervenpunkte am Gurt ist dort die empfindsamste Stelle zum Treiben. Schenkel besser mit etwas Tendenz nach vorne, nie zu weit zurück. Abschnauben ist essenziell! Es signalisiert, dass die WS aufgewölbt ist, die Rippenmuskulatur sich gedehnt hat, was den Brustraum erweitert, und das Pferd auch innerlich losgelassen hat. Erst jetzt kann Biegearbeit zum Ziel führen, da die Rippenmuskulatur dem Reiterschenkel keinen Widerstand mehr entgegensetzt. Alles das führt zur Losgelassenheit. Sie ist erreicht, wenn d. P. bereit ist, in allen drei GGA seinen Hals nach v/a zu dehnen. Ziel: schwingender Rücken, taktmäßige Bewegung, ohne zu eilen vorwärts. Der Reiter kommt zum Treiben und kann geschmeidig sitzen. Anlehnung ist die stete, weich-federnde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Anlehnung besteht, wenn d. P. ans Gebiss tritt und zwar in jedem Rahmen! Der Begriff der Anlehnung ist zu differenzieren, da sie in den verschiedenen Phasen der Ausbildung und des täglichen Reitens unterschiedlich in Erscheinung tritt. Erste Stufe ist die einfache Kontaktaufnahme d. P. mit dem Gebiss, welches der Reiter d. P. passiv hinhält, sodass es es finden kann. Der berühmte Satz vom „das Pferd sucht die Anlehnung, der Reiter gestattet die Anlehnung." Nie mit den Zügeln rückwärts wirken, sonst fällt die WS durch, was Anlehnung verhindert und die Losgelassenheit mindestens stört, im schlechtesten Fall aufhebt (vorne begrenzen - hinten schieben lassen.). Anlehnung ist das Ergebnis richtig entwickelter Schubkraft, durch angemessenes Treiben vertrauensvoll an die Hand. Selbsthaltung stellt sich ein, wenn d. P. bei aktiver HH in sein Gleichgewicht findet. Die Beizäumung ist eine Weiterentwicklung der A. Sie zeichnet sich aus durch beginnendes Tragen der HH, passiv tragenden Rücken, beginnende Aufrichtung und vermehrtes Nachgeben, Beugen im Genick. Die Höhe der Anlehnung, auch als Aufrichtung zu verstehen, steht in direktem Zusammenhang mit dem Grad der Versammlung. Die durch Handeinwirkung erzielte absolute Aufrichtung ist gekennzeichnet durch falsches Gehen; die HH hebelt nach hinten heraus, ist weg, der Rücken trägt im reiterlichen Sinne nicht mehr. Sie ist damit kein Ziel und darf keinesfalls Ergebnis reiterlicher Arbeit sein. Der Begriff ‚durchs Genick gehen' ist zweifach zu verstehen. In der ersten Phase geht d. P. durch die Ganasche, die sich öffnet. Dabei ist in Dehnungshaltung die Unterhalsmuskulatur abgespannt, die Ganasche locker und geöffnet. Im tatsächlichen Sinne durchs Genick geht das Pferd nur in Momenten höchster Versammlung. Dabei richtet sich die HWS ähnlich der BWS passiv auf, die HWK stehen quasi wie ein Turm von Bauklötzchen aufeinander. Die gesamte Halsmuskulatur, besonders aber die Strecker arbeiten und stabilisieren so die HWS passiv. Das Pferd trägt seinen Hals jetzt passiv mit der WS und kann nun auch die Oberlinie entspannen und damit in Dehnung behalten. Tragen durch eigene Statik. Nur das ist durchs Genick gehen. Also: In Dehnungshaltung geht d. P. durch die Ganasche. Erst in der Versammlung erfolgt das plane Aufeinanderstellen der HWK und es kommt zum Tragen durch Statik. Entwicklung der Schubkraft - Schwungentwicklung. Sie ist gekennzeichnet durch ein aktiveres Abfußen und energischeres Durchschwingen des insgesamt aktiveren Hinterbeines. Auf ein Mehr an Treiben soll der HF aktiver werden, ohne dass sich das Tempo ändert. Zunächst nur Tritte verlängern auf geraden Linien. In Maßen vor und zurück. Bevor gesteigert werden kann, muss die Durchlässigkeit weiter entwickelt sein. Rahmenerweiterung = Öffnen der Ganasche. Das Vorführen des VB soll mit erhobenem Unterarm erfolgen und zum Schluss wird die Röhre gestreckt. Ein Vorführen des sofort vollständig gestreckten VB ist ein fehlerhafter Bewegungsablauf, denn hierzu muss der Unterhals angespannt sein, was unerwünscht ist. In dem Maße, wie die Ganasche geöffnet wird, muss das HB aktiver werden. Ziel: einen schwingenden Grundtrab erzeugen. Schwung ist das Ergebnis reiterlicher Arbeit. Er nutzt den natürlichen Gang und seine Schwunganlage und fügt Losgelassenheit, Schub der HH und Durchlässigkeit hinzu. Geraderichtung. Reiten in Stellung richtet die beiden inneren Beinpaare auf eine Linie. Schultervor das äußere Beinpaar, Schulterherein positioniert die Diagonale innerer HF und äußerer VF. Zwischen den drei Übungen wechseln. Pferde, die so geschult werden kommen ins Gleichgewicht. Schulterherein in Konterstellung (kann in Dehnung auch im Leichttraben geritten werden). Problem ist nicht die feste Zwangsseite sondern die hohle. Die nS erzeugt einen ausweichenden HF, meistens der rechte, einen festen Rücken und breites Treten hinten. Traversale im Leichttraben auf dem falschen Fuß möglich. Beim gerade gerichteten Pferd wirkt die Schubkraft voll in Richtung des Schwerpunktes. Die Hanken sind nur Hüfte und Knie, nicht aber Sprung- und Fesselgelenk. Versammlung siehe oben, war in Münzenberg eher kurz. Bei der Arbeit in beide Richtungen der Gangmaße arbeiten, Skizze vom versammelten bis zum starken Trab. Richtiges Procedere bei der Arbeit: 1. V/A Dehnen bei schwingendem Rücken und freiem Tritt. 2. Verstärktes Aktivieren der HH bei einfühlsamem elastischem Gebrauch der Zügelhilfen. 3. Vermehrte Tragfunktion und Setzung der HH bei natürlicher Aufrichtung in den versammelten Gängen. Alles andere ist falsch! Nochmal aus anderer Sicht: 1. Auf innere Hilfen nachgeben - außen Stellung mit Kontakt zulassen. Der äußere Zügel muss da sein, um gefunden werden zu können. 2. Herandehnen an den äußeren Zügel - suchen - finden - sich von ihm führen lassen - verwahren. 3. Wechsel zwischen inneren und äußeren Hilfen mit Wechsel der Diagonale! Abschließend noch einmal:
Nochmal: Durchlässigkeit ist die entscheidende Eigenschaft des richtig gerittenen Pferdes!
Anhang
Alois Podhajsky: Richtige Anlehnung und Abdrücken (halber Arrêt)
(aus ‚Die klassische Reitkunst‘, Seite 94 ff.)
Es wird am Beginn dieses Ausbildungsstadiums neben allen anderen Forderungen die unbedingte Notwendigkeit bestehen, beim Pferd eine richtige Anlehnung zu erreichen und in weiterer Folge die Versammlung in steigendem Maße zu verbessern. Beides stellt ein auf längere Sicht gestecktes Ziel dar, das der Reiter aber nie aus den Augen verlieren oder beim Lehren neuer Übungen vergessen darf.
Jedes Pferd wird beim Anstellen beider Zügel diese verschieden annehmen: auf der einen Seite fester und auf der anderen leichter oder gar nicht. In der Reitersprache ausgedrückt macht sich das Pferd auf der einen Seite steif und auf der anderen hohl. Gleichzeitig wird das Hinterbein der steifen Seite weniger gebogen und das der hohlen Seite vermehrt untertreten, aber abweichend in Richtung der hohlen Seite. Damit ist das Schiefgehen des Pferdes gegeben. Nahezu alle Reitpferde neigen zum Schiefgehen, nur wird der Grad dieser Schiefe von Natur aus verschieden sein. Diesen Fehler zu bekämpfen und die Anlehnung auszugleichen obliegt dem Reiter während seiner ganzen Arbeit - bis zum fertigen Schulpferd. Die Beseitigung der Schiefe wird schon beim jungen Pferd leichter möglich sein als beim Schulpferd, das nicht schon im Zuge seiner Ausbildung gerade gerichtet worden ist. Zur Erzielung der gleichmäßigen Anlehnung wird der Ausgleich der Zügelanzüge folgendermaßen hergestellt: Der Reiter stellt beide Zügel gleichmäßig an und trachtet, dass das Pferd die Anlehnung in die Tiefe sucht. Erst wenn dies der Fall ist, kann mit der Gleichstimmung der Zügelwirkung begonnen werden. Meistens werden die Pferde beim Anstellen der Zügel vermehrte Stellung nach einer Seite nehmen - vorwiegend, aber nicht immer, nach rechts. Nun stellt der Reiter den Zügel der hohlen Seite, also zum Beispiel der rechten, fester an und versucht durch kurze Zügelanzüge auf der linken Seite - dem an der Spanischen Reitschule genannten Abdrücken (halben Arrêt) - dem Pferd die richtige Stellung zu geben. Der halbe Arrêt erfolgt immer in der Bewegung. Nur am Beginn der Ausbildung kann er dem jungen Pferd im Halten begreiflich gemacht werden. Vor dem Abdrücken muss das Pferd mit Sitz und Schenkel gut nach vorn gehalten werden, damit beim Abdrücken der Schwung nicht verloren geht und das Pferd nicht langsamer wird. Sollte es nicht gleich dem kurzen Zügelanzug auf der steifen Seite Folge leisten, so muss dieser sofort nachgeben und wiederholt werden, denn es darf unter keinen Umständen zu einem Ziehen mit dem Zügel kommen. Leistet es aber den kurzen oder den wiederholten Zügelanzügen Folge, was dann sein wird, wenn es in den Ganaschen nachgibt und die verlangte Stellung annimmt - gleichsam mit dem Kopf ein kurzes „Ja" nickt -, dann hören der Zügelanzug und die vortreibenden Hilfen sofort auf und der Reiter wird sein Pferd für einen kurzen Augenblick nur mit dem Zügel der hohlen Seite führen. Beim Abdrücken links muss das Pferd zum Beispiel mit Sitz und beiden Schenkeln vorgetrieben werden: dem linken, damit es durch die Zügelwirkung nicht im Untertreten des linken Hinterfußes nachlässt und dem rechten, damit es sich dicht durch Ausweichen mit der Kruppe nach diese Seite der ihm unbequemen Forderung des Reiters zu entziehen versucht. Hierbei bleibt der rechte Zügel (der der hohlen Seite) in steter Anlehnung mit dem Pferdemaul. Dies ist sehr wichtig! Es soll doch das Pferd an diesen Zügel Anlehnung nehmen. Diese kann auf der hohlen Seite vorübergehend auch fester werden. Hält aber der Zügel der hohlen Seite nicht entsprechend aus, so verliert das Abdrücken jeden Wert, weil das Pferd zwar von der Anlehnung am Zügel der steifen Seite weggebracht, nicht aber zur Annahme des Zügels der hohlen Seite kommen wird.
Sobald das Abdrücken zum Erfolg geführt hat, was man am besten daran erkennen wird, dass das Pferd zum Beispiel nach dem Abdrücken links mit der Anlehnung am rechten Zügel die Stellung links beibehält (Prüfstein für das richtige Nachgeben links), müssen die einseitigen Zügelanzüge aufhören, sonst endet dieses wunderbare Hilfsmittel in einem Hin- und Hergeigen mit den Zügeln, einem der größten Fehler, den der Reiter begehen kann.
Es kann aber auch der Fall eintreten – sei es im Zuge der soeben beschriebenen Ausbildung oder gleich am Beginn der Arbeit in mehr versammelten Gängen -, dass sich das Pferd auf beide Zügel legt und eine viel zu feste Anlehnung nimmt. Das ist ein Zeichen dafür, dass es sich nicht im absoluten Gleichgewicht befindet und auf der Vorhand geht.
Die Ursache dieses Fehlers kann verschiedener Art sein, wird aber meist darin liegen, dass die Schenkel zu viel treiben und das Kreuz des Reiters den Schenkeldruck nicht genügend aufzufangen vermag. Die Schenkelhilfen fördern daher mehr die Schub- als die Tragkraft der Hinterbeine. Tempowechsel mit vermehrter Kreuzeinwirkung und häufigen nachgebenden und annehmenden Zügelanzügen sowie kurzes Abdrücken nach oben stellt das beste Gegenmittel dar. Unter keinen Umständen darf der Reiter versuchen, das Pferd mit beiden Zügeln aufzurichten oder gar durch Zügelrucke den Druck der Anlehnung zu vermindern.
Also zusammenfassend: Zum überwiegenden Teil wird durch das Abdrücken eine tiefere Einstellung von Hals und Kopf bezweckt. Der kurze Zügelanzug erfolgt in diesem Falle mit tief gestellter Hand gegen die entgegengesetzte Hüfte des Reiters. Soll eine Höherstellung von Hals und Kopf – also eine Aufrichtung – erreicht werden, so wird die Hand etwas höher genommen, und es erfolgt der Zügelanzug in Richtung der entgegengesetzten Brustseite des Reiters.
Pferde, die zum Beispiel dazu neigen, sich rechts hohl zu machen, werden dann in weiterer Folge auf der rechten Hand mit möglichst wenig Stellung und auf der linken Hand, auf der sie sich zu versteifen versuchen, mit deutlicher Stellung geritten. Dies gilt bis zum Schulhengst, nur darf bei diesem das Abdrücken von Beobachter nicht mehr wahrgenommen werden.
Es wird im Zuge der Ausbildung manchmal vorkommen, dass Pferde die hohle und steife Seite wechseln – was immer als sehr gutes Zeichen zu werten ist, nur muss es der Reiter auch wahrnehmen und sofort seine Hilfen in umgekehrter Weise einsetzen.
Wohlgemerkt: Das Abdrücken ist nur dann möglich, wenn das Pferd auf den einseitigen Zügelanzug nach unten nachgibt. Sollte es jedoch beim Abdrücken den Kopf hochnehmen und sich sogar im Hals kropfen, dann ist es für diese Hilfe noch nicht reif oder es haben sich im ersten Ausbildungsabschnitt Fehler eingeschlichen, die der Reiter unbeachtet gelassen hat. Dann gibt es nur ein Mittel: Zurück zu dieser Ausbildungsperiode und richtig das Suchen des Zügels in der Tiefe lehren – das für einen schwingenden Rücken und das Untertreten der Hinterbeine so unermesslich wichtig ist.
Hand in Hand mit dem Ordnen der Anlehnung geht das Geraderichten des Pferdes, weil erst dann die richtige Versammlung mit allen ihren Vorzügen möglich sein wird.
Gerade gerichtet wird – wie schon im ersten Ausbildungsabschnitt des jungen Pferdes – immer durch das Einstellen der Vorhand auf die Nachhand. Dies wird an der Wand, die dem Pferd die einzuhaltende Richtung fixiert, leichter sein als auf einer Linie ohne Wand. Die Vorhand des Pferdes wird mit beiden Zügeln so weit von der Wand hereingeführt, dass die Hinterfüße in die Fußspuren der Vorderhufe treten können. Nur wenn die Hinterbeine dorthin treten, wird das Pferd im Gleichgewicht sein. Gleichzeitig müssen die vortreibenden Schenkel und der Sitz des Reiters dafür sorgen, dass der Fluss der Bewegung nicht unterbrochen wird. Das Hereinführen der Vorhand nach der Seite, auf der sich das Pferd steif macht, wird immer leichter sein, weil es diesen Zügeln annimmt. Auf der anderen Seite wird es hingegen versuchen, durch vermehrtes Biegen im Hals den Zügelanforderungen des Reiters zu folgen, um sich das ihm zunächst noch unbequeme Geraderichten zu ersparen. Auch wird es sich auf diese Weise sträuben, einen eingefleischten Fehler aufzugeben. Hier muss es der abdrückende äußere Zügel zur Raison bringen und dazu veranlassen, die Vorhand und nicht nur den Hals hereinzustellen.
Erst das gerade gerichtete Pferd gibt dem Reiter die Möglichkeit der Gymnastizierung und der Ausbildung seines Schützlings bis zu den höchsten Anforderungen der Reitkunst. Daher ist auch in allen seriösen Reitbüchern immer wieder folgender Satz zu finden: „Richte dein Pferd gerade und reite es vorwärts“. Ich möchte diese Version dahingehend abwandeln: „Nur wenn dein Pferd gerade gerichtet ist, kann es mit vollem Schwung nach vorwärts gehen“.
Textende A. P.
Anmerkung: Steinbrecht hat er wohl falsch zitiert. Im Original lautet es: „Reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade": Das wollte er wohl auch schreiben, sonst ergibt sein letzter Satz keinen Sinn.
Ergänzend die Kapitel über Ausbildungsphasen und Schulung aus Band I der FN-Richtlinien:
Gewöhnungsphase (GP)
Die Punkte der GP sind, sowohl in den ersten Wochen der Ausbildung des jungen Pferdes als auch in der Lösungsphase jeder Trainingseinheit, vorrangige Ziele.
Die Festigung des Taktes durch Einhalten eines bestimmten, dem jeweiligen Pferd angepassten Grundtempos, ist das erste Ziel. Gleichmäßiges Treiben und eine tief gestellte, ruhige und elastische führende Hand sind hierzu Vorbedingungen. Missverstandenes „Vorwärtsreiten" führt zu übereilter Fußfolge und zu Taktstörungen. Nicht das schnelle Tempo bedeutet „vorwärts", sondern die Anregung der HB zum fleißigen, kraftvollen Abschieben der Last nach vorne. Das Gleichmaß der Bewegung hat Vorrang vor allem anderen. Als Taktfehler werden in erster Linie Unregelmäßigkeiten in der Fußfolge bezeichnet, wie zum Beispiel das passartige Gehen im Schritt oder der Vierschlag im Galopp. Im Trab sind kurze, unregelmäßige und verspannte Tritte oder die so genannten Schwebetritte die häufigsten Fehler. Meistens wurden bei Pferden, die Taktfehler oder Taktstörungen zeigen, mit zu viel Handeinwirkung und zu wenig treibenden Hilfen geritten. Lösende Übungen mit häufigen Übergängen, einschließlich „Zügel-aus-der-Hand-kauen-lassen", können Abhilfe schaffen ebenso fachgerechtes Longieren, Bodenrickarbeit, evtl. Springgymnastik oder auch das Reiten im Gelände.
Die Losgelassenheit ist ein zentrales Ausbildungsziel, das niemals vernachlässigt werden darf und immer wieder von neuem überprüft und sichergestellt werden muss. Um die L. unter dem Reiter zu erlangen, muss zunächst gewährleistet sein, dass das Pferd zufrieden und innerlich entspannt ist. Durch regelmäßigen, einfühlsamen Umgang und ausreichende Bewegung kann dies erreicht werden. Mit der inneren L. wird auch die äußere L. relativ schnell erreicht. Lösende Übungen dienen sowohl dem Aufwärmen von Muskeln, Sehnen und Gelenken als auch der Verbesserung der Rückentätigkeit. Gleichzeitig wird das Durchschwingen und Herantreten der HB aktiviert; das Pferd dehnt sich an die Reiterhand heran und findet vertrauensvoll die Anlehnung.
Bei Problemen in der weiterführenden Ausbildung muss auf lösende Grundübungen zurückgegangen werden. Die meisten Ausbildungsfehler haben ohnehin mehrere Ursachen und müssen in ihrer Gesamtheit behoben werden. Fast immer aber fehlt es an L. und dem Reiter sind in seiner Einwirkung Fehler unterlaufen. Dies äußert sich auf vielfältige Weise, zum Beispiel: Taktfehler, wenig Aktivität der HB, fester Rücken, mangelnde Maultätigkeit und Zungenfehler, Schiefgehen.
MERKE: Oberstes Kriterium jeder gelungenen Übung oder Lektion sind die Taktmäßigkeit (Taktreinheit) und die Losgelassenheit (Zwanglosigkeit).
In der Gewöhnungs- und der Lösungsphase wird das Pferd zunächst mit leichter Anlehnung geritten, ohne aber eine Beizäumung mit der Hand erzwingen zu wollen. Sowohl das junge Pferd als auch das ausgebildete Pferd finden mit einer leichten Anlehnung am besten zu ihrem Gleichgewicht und zum taktmäßigen, losgelassenen Gehen unter dem Reiter. Durch die treibenden Hilfen und dank einer gefühlvollen Hand des Reiters wird das Pferd an das Gebiss herantreten und die Anlehnung suchen.
Der Punkt, an dem das Pferd die A. findet, wird zunächst verhältnismäßig tief liegen. Das Pferdemaul ist dabei etwa in Höhe der Buggelenke. In dieser Haltung wird die gewünschte Dehnung und Entspannung von Hals- und Rückenmuskulatur am besten möglich.
Für das Reiten über Sprünge und das Geländereiten sind Takt und Losgelassenheit ebenfalls wesentliche Voraussetzungen. Nur ein taktmäßig galoppierendes Pferd ist im Gleichgewicht und kann in einem gleichmäßigen Tempo passend zum Sprung gebracht werden. Das Vorhandensein der Losgelassenheit führt zur Leistungsbereitschaft und ermöglicht dem Pferd erst, mit Basküle über den Rücken zu springen. Das losgelassene Springpferd wird sich bei einem eventuellen Rei
|